
 |

Aktuelle Artikel
Mucs wird 10! Liebe Leser, hoch die Tassen - mucs wird 10! Das... |
Maro Nikolaidou-Murböck hat die Proben des Tanz-Theaters "Mind the gap - Achtung Abgrund" drei Monate mit ihrer Kamera begleitet.
             ... link (0 Kommentare) ... comment Im Gasteig schufen Kreisjugendring, Münchner Volkshochschule und städtische Referate Kindern aus Einwandererfamilien eine Plattform, um „ins Zentrum zu (d)rücken“.
 So viele Baseball-Caps, Muskelshirts, grobmaschige Halsketten und andere Symbole der Ghettokultur hat man in den Gasteig-Fluren bisher wohl nie gesehen. Bei der Finissage des Integrations-Projekts „Cheka?!“ präsentierten Jugendliche in der Black-Box am Samstag Musik, Tanz, Lesungen, Theater und Artistik rund um das Thema Fremdsein. Unter dem Motto „Münchner Jugendliche (d)rücken ins Zentrum“ holte eine Veranstaltungsreihe der Landeshauptstadt München, des Kreisjugendrings und der Offenen Akademie der MVHS von 24. Januar bis 9. März junge Münchner mit und ohne Migrationshintergrund in den Kulturtempel an der Rosenheimer Straße. Doch aller Druck bewegt wenig, wenn er von dem, der Platz machen soll, nicht gespürt wird. So rückten und drückten die jungen Menschen zwar mit spannenden kulturellen Beiträgen in den zentralen Kulturtempel, aber kaum einer nahm Notiz davon. Jugendliche, Sozialarbeiter und Ausländerbeirat blieben auch bei der Abschlussveranstaltung des Teilhabe-Projekts weitgehend unter sich. Keine Lokalredaktion schickte einen Fotografen, keine politische Fraktion einen hochrangigen Vertreter, selbst Kooperationspartner geizten mit ihrer Anwesenheit. So durften wieder nur Eingeweihte miterleben, wie insgesamt rund 50 Darsteller - vom Kind bis zum jungen Erwachsenen - den Nachmittag zu einem Fest ihrer Talente, einer Schau ihrer kulturellen Fähigkeiten machten. Begeisterung gleich zu Beginn, als der Jugendtreff Harthof modernen Tanz vor dem Carl-Orff-Saal präsentierte. Wie einst Sir Simon Rattle für das international beachtete Klassik-Projekt „Rhythm is it“ in Berlin, hat der Profi-Tänzer Alan Brooks, der sonst seinen Körper in den großen Theatern der Welt biegt, in München mit einem guten Dutzend junger Menschen drei Monate lang eine anspruchsvolle Tanzperformance einstudiert. Die schwierigen sozialen Verhältnisse der Schüler wurden nicht ausgeblendet, sondern zum Thema des Stückes gemacht. Das sagte schon der Titel: „Mind the gap – Vorsicht Abgrund“. Eine Ton-Diaschau der Initiatorin Maro Nikolaido-Murböck, Sozialpädagogin des Jugendzentrums, macht das Projekt zum bleibenden Gesamtkunstwerk, in dem es die Gesichter der meist aus sozial schwachen Verhältnissen stammenden Jugendlichen mit ihren Gefühlsausdrücken zwischen Angst, Mut und Glück auf Großleinwand bannte. Die unaufdringliche Kamera begleitete die Jugendlichen auf ihrem Weg von den ersten Proben voller Selbstzweifel bis zur selbstsicheren Umsetzung der komplexen Anweisungen. Die Bilder vermitteln eine Ahnung von der Energie, die der mal nachdenkliche, mal lachende – aber immer konzentrierte Tanz-Trainer bei seinen Schützlingen wecken konnte: „Ich will zeigen, dass es verständlich ist, wenn sie sagen: Hier in der Ecke ist es unbequem“, sagt Brooks. Mehr Raum zur Entfaltung können auch die Teilnehmer aus dem Flüchtlingsheim gebrauchen – im wörtlichen Sinne. In München sind Kinder von Asylbewerbern gewöhnt, mit vier Personen in einem Zimmer von 13 Quadratmetern zu leben. Weil auch für die musische Erziehung kaum Geld da ist, bleiben wenig Alternativen zum ältesten Instrument der Menschheit. Mit Trommeln aus Senf- und Kartoffelsalat-Eimern verschafften sich die Kinder aus der Unterkunft in der Heinrich-Wieland-Straße in der Black Box Gehör. Einige hätten trotzdem lieber eine Breakdance-Nummer präsentiert. Fünf sehr junge Buben drehen sich auf dem weichen Gasteig-Teppich Kopf stehend um die Wette. Viel Wertvolles für die Integrationsdebatte hätten Münchner auch aus den abgedruckten Interviews mit Hauptschüler aus der Bernaysstraße und der Guardinistraße mitnehmen können. In der Fotoausstellung „Wer einen Freund hat, ist kein Verlierer“ zeigen die Antworten, dass die Parallelgesellschaft längst Wirklichkeit geworden ist. Etwa wenn ein Junge in der Rubrik „Ich hatte einen Freund“ sagt, „Es ist blöd, dass er so jung, mit 16, bei einer Messerstecherei ums Leben kam.“ Oder wenn ein 15-jähriges Mädchen erzählt: „Meine beste Freundin ist, meine Halbschwester. Sie ist 14. Sie ist alles für mich. Seit mein Vater eine neue Freundin hat, hat er für uns eine Wohnung gemietet. Wir machen alles allein: waschen, bügeln, …“ Ernüchternd auch die Realitäten eines jungen Ausländers bei Wahl seiner Geliebten: „Mein Vater wollte nicht, dass ich eine deutsche Freundin habe.“ Viele junge Einwandererkinder haben es sich in ihren Nischen trotzdem gemütlich gemacht. Mit Musik-Kollektiven hoffen viele auf den großen Durchbruch. Und plötzlich erscheinen die Devotionalien der afroamerikanischen Unterklasse nicht mehr so weit hergeholt. Die drei Sängerinnen der Hip-Hop-Gruppe „Black`key`sis“ haben sich die Anfangsbuchstaben ihres Bandnamens auf die kurzen Taschen ihrer sehr kurzen Hosen genäht. Dem tobenden Publikum erscheinen die drei schwarzen Stimmen reif für eine große Karriere. Sie werden als „Mädchen aus Angola“ angekündigt, obwohl zwei von ihnen hier geboren sind. Die 16- und 17-jährigen Mädchen aus dem Nordschwabinger Jugendtreff Bierderstein behaupten, so was störe sie nicht. Hauptsache sie selbst fühlten sich in München „heimisch“. Weil das Thema den Medien offenbar „fremd“ war, verpassten viele Münchner ein Projekt, das frei von Integrations-Pathos und ohne Image-Kalkül kultureller Institutionen authentische Münchner Nischenkultur ins Zentrum rückte. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema gewagt, haben deutsche Lehramtsanwärter der LMU. In ihrem Theaterprojekt „Über das Fremdsein“ viel der Satz: „Fremd ist der Weintrinker auf dem Oktoberfest“. Eine schlichte Weisheit über Nischendasein, die wohl auch im Zentrum der Gesellschaft ankommt. Zur "Cheka" - Bildergalerie. ... link (0 Kommentare) ... comment Jede Party lebt von ihren Gästen. Bei 18jetzt seid es ihr. Wir zeigen euch die Gesichter zum Fest. So sehen Sieger aus ...
... link (0 Kommentare) ... comment Inzwischen ist die Party in vollem Gange, die Besucher feiern, chatten, diskutieren. Immer mehr junge Leute drängen ins Rathaus. Hier gibt's eine bunte Mischung an Eindrücken vom Fest.
... link (0 Kommentare) ... comment Der Regisseur und Dramatiker René Pollesch räumt mit Theater-Klischees auf und bringt Schauspieler nicht nur mit seinem Tempo an ihre Grenzen.
< Anja-Maria Foshag 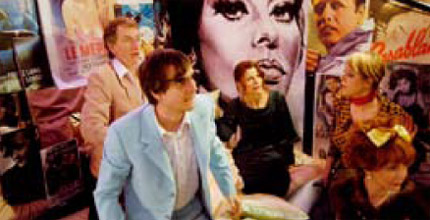 Das Stück „Solidarität ist Selbstmord“ des jungen Regisseurs René Pollesch wird gerne als „orgeastisches Highspeed-Theater“ beschrieben. Die Definition trifft exakt, was Zuschauer an einem Pollesch-Abend erleben: lautes, schnelesl, verwirrendes Schauspiel. Der Provokations-Profi macht „Theater so schnell wie die Formel 1“, titelte die Bild-Zeitung, „Handlung, Ideen, Andeutungen werden gewechselt wie Reifen beim Boxenstopp“. Bernd Moss, Schauspieler und Pollesch-Experte, sagt über seine erste Begegnung mit einer Pollesch-Inszenierung: „Der Text kam so schnell, dass ich dachte, ich lache später.“ Anna Böger, Darstellerin an den Kammerspielen, erzählt über die Zusammenarbeit mit Pollesch: „Es geht zum Beispiel um die Frage, wie nähert man sich auf der Bühne dem Thema Unterschicht. Da sagt Pollesch, Man kann es im Theater nicht einfach so machen, dass man einen Schauspieler in dreckigen Unterhosen hinsetzt, der dann Prekariat spielt.“ Pollesch, 1962 in der hessischen Provinz bei Friedberg geboren, verwehrt sich nicht nur klischeehaften Theaterbildern. Er will Dinge, die unter den Tisch fallen, auf die Bühne bringen. Als einer der ersten schrieb er über prekäre Arbeitsverhältnisse der Praktikums-Generation, angetrieben durch seine eigene Biografie. Ende zwanzig nach seinem Theaterwissenschaftsstudium in Gießen war er nach einigen erfolgreichen Arbeiten bei den Auftraggebern plötzlich out. Pollesch sagt über diese Zeit: „Nicht gefragt zu sein in dem Bereich, in dem ich arbeiten wollte, das war psychischer Stress.“ Was aber, wenn aus dem Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, nichts wird? „Für die Arbeit am Selbst gibt es eben nicht genug offene Stellen“, sagt Pollesch, „Selbstverwirklichung ist wie ein diffuses Versprechen. Wie die wahre Liebe, die jeder erleben will. Es gibt diese Behauptung, dass die wahre Liebe allen offen steht. Aber vielleicht ist das gar nicht so.“ Damit kommt Pollesch auf die zentralen Themen seiner Werke, für die er Theaterautor, Dramatiker und Regisseur in Personalunion ist. Die falschen Versprechungen der globalen Marken- und Marktgesellschaft. Es geht um den Marktwert des Menschen, um die Bedeutung von Fake und Wirklichkeit, Glücksvorstellungen, Liebe und Träume. Was, wenn unsere Träume nur von Verbrechern realisiert werden können?, wird in dem Stück „Solidarität ist Selbstmord“ gefragt. Und kann Liebe echt sein und gleichzeitig bezahlt? Liebe, das gefragteste Gut, entzieht sich den Gesetzen des Marktes, sagt Polleschs Hausphilosoph Carl Hegemann. Pollesch will sich vom „Repräsentationstheater“ absetzen, das dem Publikum einen Hamlet aufzwingen wolle und damit die eigene Realität vergessen mache. „Alles, was nicht mit den Schauspielern zu tun hat, wird bei uns rausgeworfen“, sagt Pollesch über seine Herangehensweise. Mittlerweile ist Pollesch mit seinem Polittheater selbst zu einer Marke geworden, die sich gut verkauft. Seine Durststrecke Anfang der Neunziger ist überstanden, er ist zu einem der wichtigsten zeitgenössischen Regisseure geworden, wird als „Erneuerer des politischen Theaters“ gefeiert und mit den wichtigsten Preisen in der deutschen Theaterlandschaft bedacht. Seine Arbeiten machen Station in Tokio, Wien und Hamburg. Heute ist er künstlerischer Leiter des Praters der Berliner Volksbühne. Seine Stückeerzählen von Menschen auf der Suche und immer zeigen sieSchauspieler, die sich um Kopf und Kragen reden, als könnten sie damit ihrer selbst ein wenig bewusster werden. Polleschs Theater ist nicht nur laut, schnell und verwirrend. Es macht vor allem nachdenklich. In einem Gespräch hat er einmal gesagt, „weil wir uns nicht entsorgen können, müssen wir Lösungen suchen“. ... link (3 Kommentare) ... comment |
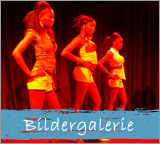 Neueste Kommentare
Kost nix Die fetteste Party des Wochenendes - und dann auch... |